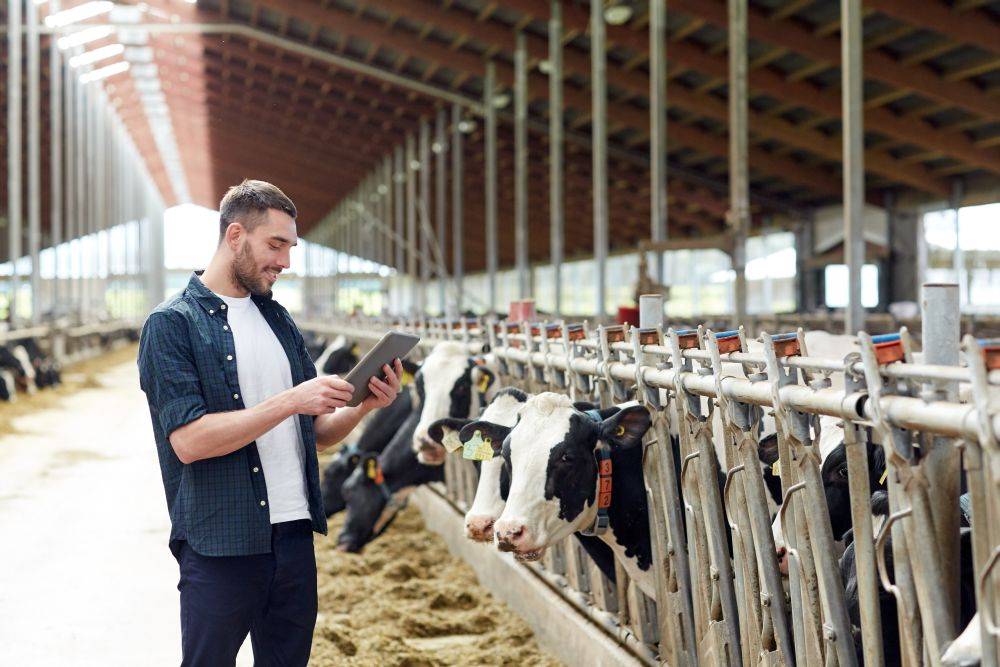
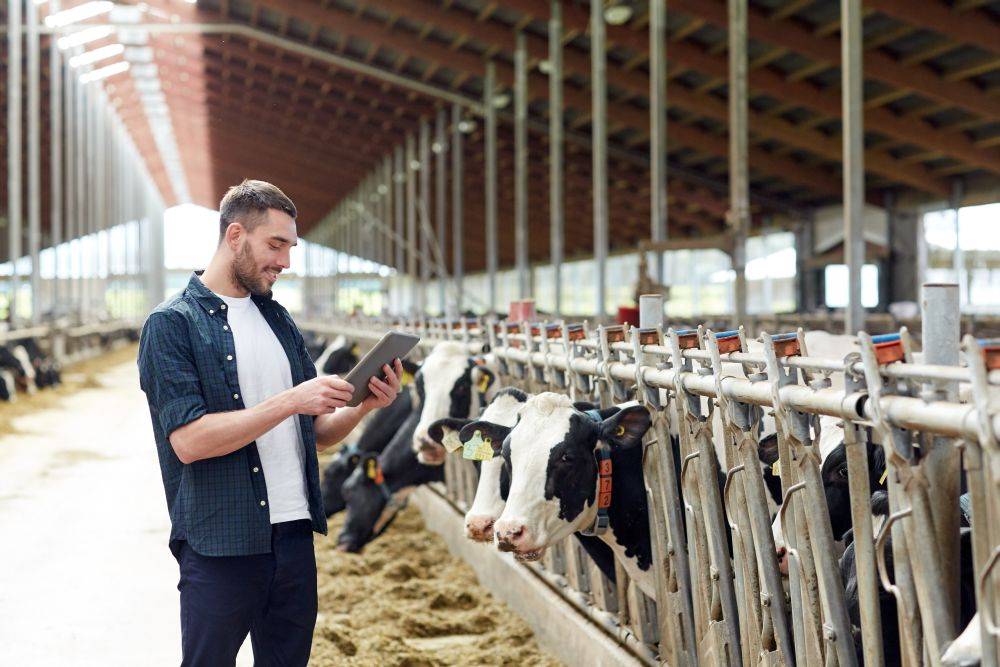
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft berechenbar machen
Die Digitalisierung ist längst in der Landwirtschaft angekommen – verpackt in Begriffen wie „Digital Farming“, „Smart Farming“, „Precision Farming“ bzw. Präzisionslandwirtschaft oder „Landwirtschaft 4.0“. Im Mittelpunkt steht dabei, dass softwaregestützte Datenerfassung und Datenverarbeitung helfen, Arbeitsschritte auf den landwirtschaftlichen Flächen oder im Büro zu optimieren und teilweise zu automatisieren.
Und genau das ist das Forschungsfeld von Jörg Dörr: „Die große Frage, die alle umtreibt, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen, ist: Wie können wir auch in Zukunft die rasant wachsende Weltbevölkerung ernähren? Und das angesichts unterschiedlicher Anspruchshaltungen unserer Gesellschaft: Einerseits werden wir mehr Menschen – der Bedarf an Lebensmitteln steigt. Andererseits werden Stimmen laut, die zu Recht mehr Nachhaltigkeit und mehr Tierwohl fordern. Das eine treibt die Produktivität an, das andere kann sie verringern. Ein Teil der Lösung kann die Digitalisierung sein, indem sie mittels intelligenter Technik die gleiche Produktivität mit weniger Ressourceneinsatz ermöglicht.“
Den CO₂-Fußabdruck der Milchwirtschaft im Blick
Der Informatiker forscht insbesondere zur Interoperabilität – also dazu, wie gut unterschiedliche digitale Systeme miteinander interagieren können. Denn mittlerweile gibt es Tausende verschiedene Software-Anwendungen zur Verwaltung von Ackerflächen und Viehbestand sowie zur Planung von Bewirtschaftungsmaßnahmen (Säen, Düngen usw.) und Managementarbeiten im Stall. Die betriebsspezifischen Informationen liegen meist verteilt in vielen „Datensilos“.
Wie Interoperabilität in der Praxis gelingen kann, zeigte Dörr zuletzt im Verbundprojekt „Nachhaltigere Milch“, gefördert durch das EU-Programm „Europäische Innovationspartnerschaft EIP-Agri“. Ziel der Zusammenarbeit von Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Landwirtschaft, insbesondere Partnern des Fördervereins Friends of Digital Farming e.V. war es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, um den CO₂-Fußabdruck eines Milchviehbetriebs zu erfassen und zu verbessern.
290 betriebsspezifische Informationen erforderlich
Eines war von Anfang an klar: Landwirtschaftliche Betriebe haben nicht darauf gewartet, zusätzlich zu bereits bestehenden Dokumentationspflichten nun auch noch Nachhaltigkeitsberechnungen durchzuführen. Sie stehen ohnehin unter großem Druck. Daher war es Dörr wichtig, eine Lösung zu entwickeln, die das Berechnen des CO₂-Fußabdrucks so einfach wie möglich macht.
Er arbeitete eng mit den drei landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, insbesondere der Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle, die das Projekt leitete. Aus der Praxis ergab sich eine weitere Herausforderung: „Es gibt nicht nur einen Nachhaltigkeitsrechner, sondern aktuell über 100 verschiedene Tools. Daher kann es passieren, dass ein Landwirt gleich mehrere dieser Rechner mit Daten füttern muss – allein schon, weil diejenigen, die Transparenz fordern – Molkerei, staatliche Behörden und weitere Institutionen – jeweils unterschiedliche Vorgaben machen“, erklärt Dörr. Auch sind die Rechner bislang nicht standardisiert – sie basieren auf unterschiedlichen Berechnungslogiken und Datenmodellen. „Die einmalige Dateneingabe in ein solches Tool dauert bis zu vier Stunden – dabei müssen je nach Konfiguration um die 290 Informationen bzw. Datenpunkte meist händisch eingegeben werden.“
Ein System, das wie eine Spinne im Netz agiert
Als technischen Kern seiner Lösung entwickelte das Team von Dörr ein Dashboard, das wie eine Spinne im Netz zwei Welten miteinander verbindet: das Büro des Landwirts und die Nachhaltigkeitsrechner. Entstanden ist eine Benutzeroberfläche, die über einen angeschlossenen Server sowohl mit den Verwaltungs- und Planungssystemen der landwirtschaftlichen Betriebe als auch mit den Nachhaltigkeitsrechnern kommunizieren kann.
Hierfür implementierte und adaptierte sein Team die von den Systemherstellern bereitgestellten Application Programming Interfaces (APIs), um die Systeme und das Dashboard technisch miteinander zu verknüpfen. So kann das Dashboard die für die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks benötigten Daten aus den verschiedenen Datensilos importieren, sie visualisieren und in die Nachhaltigkeitsrechner übermitteln. Von dort gelangt das Ergebnis automatisch zurück ins Dashboard.
Da längst nicht alle digitalen Werkzeuge eine API besitzen, hat Dörr weitere Brücken gebaut: Das Dashboard kann auch Informationen aus Excel-Dateien und PDF-Dokumenten, etwa Laborberichten zu Futtermittel- oder Bodenanalysen, importieren.
Was ist das Dashboard wert?
Der große Vorteil: Alles, was bereits in einer der verknüpften Datenquellen erfasst wurde, ist automatisch verfügbar. Im Projekt betraf das fast die Hälfte der Informationen, die ein Nachhaltigkeitsrechner benötigt.
Zudem gibt es wiederkehrende Daten, die sich über die Jahre kaum ändern. Diese lassen sich im Dashboard speichern und wiederverwenden. Insgesamt kann die von Dörr entwickelte Lösung den Landwirtinnen und Landwirten das Zusammensuchen und Eingeben von rund 70 Prozent der erforderlichen Informationen abnehmen – das bedeutet eine enorme Zeitersparnis.
Zusätzlich ermöglicht das Dashboard sogenannte „Was-wäre-wenn“-Szenarien, die Milchviehbetriebe bei der Optimierung ihres CO₂-Fußabdrucks unterstützen. „Das System simuliert beispielsweise, was passiert, wenn ich das Tierfutter anders zusammenstelle oder bei der Düngung Nitrifikationshemmer einsetze, die den Stickstoff im Boden länger pflanzenverfügbar halten. Solche Funktionen hatten sich die Betriebe im Projekt ausdrücklich gewünscht.“
Datenräume statt Insellösungen
In Zukunft, so hofft Dörr, könnten Datenräume das bisher stark fragmentierte digitale Ökosystem in der Landwirtschaft unterstützen. Im April startete die Initiative Common European Agricultural Data Space (CEADS), die einen gemeinsamen europäischen Agrardatenraum schaffen will. Ziel ist es, eine sichere, souveräne und vertrauenswürdige Datennutzung zu ermöglichen – herstellerübergreifend und mit echter Durchgängigkeit. Auch hier wirkt Dörr mit, allerdings in seiner Rolle als erweiterte Institutsleitung am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE: Er und sein IESE-Team übernehmen dort eine zentrale Funktion als Technologiepartner.
Darüber hinaus beschäftigt sich Dörr intensiv mit der Akzeptanz digitaler Lösungen und Künstlicher Intelligenz (KI). Er und sein Team stehen im engen Austausch mit landwirtschaftlichen Betrieben: „Es geht nicht nur um einen Technologie-Push, sondern darum, die Technologie in Einklang zu bringen mit dem, was Landwirtinnen und Landwirte wirklich brauchen. Dazu können wir als Informatiker und Informatikerinnen einen entscheidenden Beitrag leisten.“

Du willst mehr über Digital Farming wissen?
Dann findest Du hier weiterführende wissenschaftliche Literatur:
J. Dörr and M. Nachtmann (2024), Handbuch Digital Farming, Digitale Transformationen für eine nachhaltige Landwirtschaft, Springer Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-662-67086-6
>> ZUR VERÖFFENTLICHUNG

These topics might also interest you:



